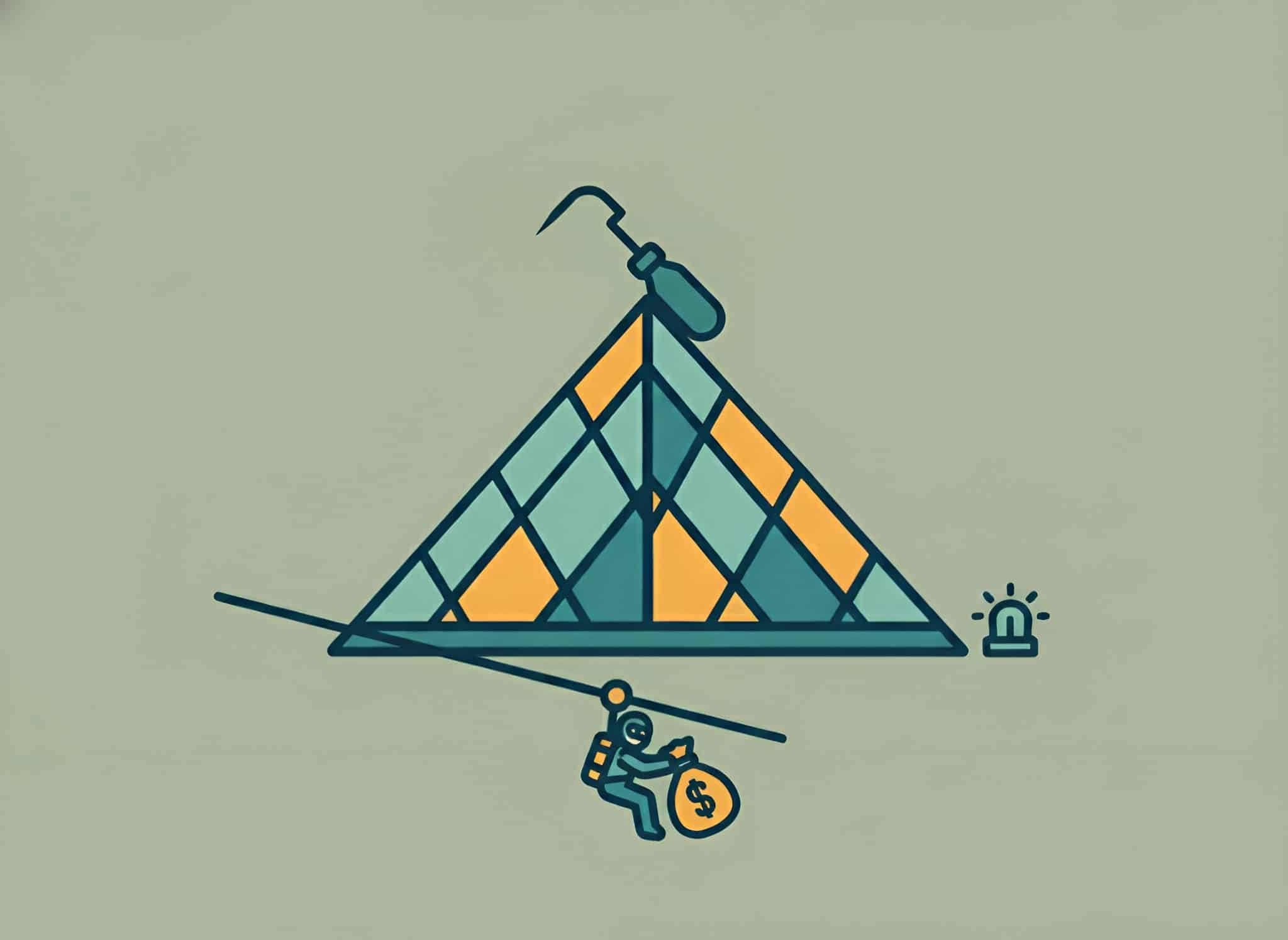Raub oder Diebstahl im Louvre-Fall? Juristische Bewertung nach deutschem Strafrecht (§§ 242, 249 StGB)
Am Morgen des 19. Oktober 2025 spielten sich im Pariser Louvre-Museum Szenen wie aus einem Heist-Movie ab: Vier als Handwerker verkleidete Täter verschafften sich mit einem Fahrzeug samt Hebebühne Zugang zur Galerie d’Apollon – jenem Teil des Museums, in dem die Juwelen der französischen Krone ausgestellt sind. Innerhalb weniger Minuten schlugen sie eine Fensterscheibe ein oder schnitten diese auf, setzten Trennschleifer ein, brachen zwei Vitrinen auf und entwendeten acht historisch bedeutsame Schmuckstücke im Wert von mehreren Millionen Euro. Die Flucht gelang zunächst per Motorroller, Teile der Beute wurden später beschädigt aufgefunden.
Mittlerweile wurde durch die Pariser Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Täter mit den eingesetzten Werkzeugen auch auf anwesendes Museumspersonal einwirkten. Der Einsatz von Schuss- oder Stichwaffen ist nicht bekannt, auch kam es zu keinen Verletzungen.
Die juristische Bewertung des Louvre-Coups
Bei diesem Fall stellen sich unterschiedliche rechtliche Frage : Handelt es sich um einen (schweren) Diebstahl oder ist bereits der Tatbestand des Raubes erfüllt? Welche sonstigen Delikte kommen in Frage? Werden einzelne Delikte verdrängt?
Der Fall ist gerade auch für Jura-Studierende und Referendare sowie Referendarinnen in Deutschland besonders relevant – sowohl für die schriftliche Examensklausur als auch für die mündliche Prüfung. Denn die zugrunde liegenden Fragen - insbesondere zu §§ 242, 249 ff. StGB - gehören zum absoluten Standardrepertoire im Strafrecht BT.
In diesem Beitrag analysieren wir den Fall nach deutschem Strafrecht.
Unproblematischer Einstieg: Hausfriedensbruch in den Louvre (§ 123 StGB)
Laut (unserem) Sachverhalt drangen die Täter in das Louvre ein, indem sie das Fenster “zerschnitten”. Hier ist an einen Hausfriedensbruch im Sinne des § 123 StGB zu denken. In der Sache ist dieser Tatbestand einfach zu bejahen:
Ein Tatobjekt ist gegeben, denn das Louvre stellt einen Geschäftsraum im Sinne der Definition dar: Ein Geschäftsraum ist ein abgeschlossener, überdachter Raum, der hauptsächlich zum Betrieb von Geschäften, allerdings nicht notwendigerweise erwerbswirtschaftlichen Zwecken dient.
Außerdem ist eine Tathandlung zu bejahen. Denn es handelt sich hier ersichtlich um ein widerrechtliches Eindringen (§ 123 I Alt. 1 StGB) bei dem die Räume des Louvre betreten wurden und eine tatsächliche Zugangshürde überwunden wurde (das geschlossene Fenster).
Dabei gingen die Täter vorsätzlich und ersichtlich rechtswidrig und schuldhaft vor.
(Schwerer) Diebstahl im Louvre: §§ 242, 243, 244, 244a StGB im Überblick
Mit dem Entfernen der Juwelen aus dem Museum haben die Täter fremde, bewegliche Sachen in Zueignungsabsicht weggenommen. Damit ist der Grundtatbestand des Diebstahls gemäß § 242 StGB erfüllt.
Dennoch zeigen die Umstände, dass hier wohl “mehr” als nur das passiert ist - denn die Kronjuwelen sind natürlich kein "normales" Diebesgut und auch das Vorgehen der Täter hat für Aufsehen gesorgt.
Was könnte zusätzlich zum (einfachen) Diebstahl einschlägig sein?
Die Täter sind in ein Gebäude eingebrochen (§ 243 I 2 Nr. 1 StGB) und haben eine Sache gestohlen, die durch ein verschlossenes Behältnis (die Vitrine) gegen Wegnahme besonders gesichert ist (§ 243 I 2 Nr. 2 StGB) und die außerdem von Bedeutung für die Geschichte ist und sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befindet (§ 243 I 2 Nr. 5 StGB).
Hier liegen wohl verschiedene Varianten des besonders schweren Falls des Diebstahls im Sinne des § 243 StGB vor. Diese Regelbeispiele stellen einen Strafzumessungsaspekt dar, der nach der Schuld gesondert geprüft werden und sich straferhöhend auswirken.
Qualifikation des § 244 StGB
Denkbar ist das Vorliegen verschiedener Qualifikationstatbestände gemäß § 244 StGB. Dabei stellen sich zwei wesentlichen Probleme, die du in der Klausur bearbeiten müsstest:
§ 244 I Nr. 1 lit. a StGB -> (P): Bestimmungsgemäße Verwendung des Trennschleifers als Waffe?
§ 244 I Nr. 1 lit. a StGB -> (P): Was definiert ein gefährliches Werkzeug?
§ 244 I Nr. 1 lit. b StGB -> (P): Verwendung des Trennschneiders “als Mittel zur Überwindung des Widerstands des Tatopfers”?
§ 244 I Nr. 2 StGB -> (P): Fortgesetzte Begehung von Straftaten geplant?
§ 244 I Nr. 3 StGB -> Einbruchsdiebstahl orientiert sich an Prüfung zu § 123 StGB
Schwerer Bandendiebstahl (§ 244a StGB)
Denkbar ist auch das Vorliegen eines schweren Bandendiebstahls. Hier ist es wichtig, die Struktur der Norm zu verstehen: § 244a StGB ist eine Qualifikation zu den “Grundtatbeständen” der §§ 244 I Nr. 1, Nr. 3, 243 I 2 StGB. Wenn diese gegeben sind, muss also nur noch als zusätzliches Qualifikationsmerkmal hinzukommen, dass eine “Bande” im Sinne der Norm vorhanden ist. Dein Ergebnis insoweit richtet sich also nach dem Ergebnis der vorherigen Prüfung.
Daneben: Drohung mit Gewalt? – Nötigung (§ 240 StGB) & Bedrohung (§ 241 StGB)
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richteten die Täter ihr Werkzeug, den “Trennschneider” drohend gegen das Wachpersonal.
Bei der bedrohlichen Geste mit einem scharfen Werkzeug kommt offensichtlich eine Bedrohung (§ 241 StGB) in Betracht, da man der Geste eine in der Zukunft liegende körperliche Gewaltausübung unterstellen kann. Durch diese Androhung von Gewalt wurden die Mitarbeiter dann dazu bewegt, die Räume zu verlassen, was eine Nötigung (§ 240 StGB) zu einer “Handlung” darstellen kann.
Zentrale Frage: Diebstahl oder Raub?
Schwerpunkt dieses Falles ist natürlich die tatsächliche Entwendung der einzelnen Schmuckstücke. Der Sachverhalt ist kurz: Mit dem Trennschneider wurden die Vitrinen aufgebrochen, die Schmuckstücke herausgenommen und die Flucht angetreten.
Neben dem oben bereits besprochenen Diebstahl könnte auch ein Raubtatbestand verwirklicht worden sein (§§ 249 ff. StGB). Der Wesensunterschied zu § 242 StGB liegt hier in dem qualifizierten Nötigungsmittel - also einer Drohung mit Gewalt oder tatsächlicher Gewalt gegen eine Person.
Was nach dem Sachverhalt klar ist: Tatsächlich Gewalt ausgeübt wurde nicht. Es kann also allenfalls eine Drohung vorgelegen haben: Laut dem Sachverhalt richtete einer der Täter den Trennschneider “bedrohend” gegen das Wachpersonal. Hier stellt sich die Frage, ob hierin schon die konkludente Aussage liegt, den Trennschneider zu nutzen, um gegenüber den Adressaten Gewalt auszuüben, wenn diese nicht flüchten.
Ob hier eine Drohung vorliegt ist letztlich Auslegungssache:
Einerseits wirkt die Geste natürlich gefährlich,
andererseits kann man hier nicht ohne weiteres auf ein konkretes “Inaussichtstellen” verweisen.
In der Klausur müsstest du wohl taktisch vorgehen:
Verneinst du hier eine Drohung, endet die Prüfung.
Bejahst du eine Drohung, geht die Prüfung weiter und es kommen ggfs. auch Qualifikationstatbestände in Betracht.
Nicht vergessen: Qualifizierter Raub
§ 250 StGB enthält verschiedene Qualifikationstatbestände, die der Qualifikation des § 244 StGB ähneln. Angenommen, du hast den einfachen Raub bejaht, müsstest du nun die einzelnen Möglichkeiten ansprechen und nach und nach durchgehen: Führten die Täter gefährliche Werkzeuge mit sich, ist der Trennschneider eine Waffe, bildeten sie eine Bande, etc.?
Nebenschauplatz: Sachbeschädigung
Zuletzt, das sollte nicht untergehen, ist zu beachten, dass auf der Flucht Teile der Beute beschädigt wurden. Hierin liegt zweifelsohne eine Sachbeschädigung im Sinne des § 303 I StGB. Hier könnte man nun darüber diskutieren, ob hierin (noch) grobe Fahrlässigkeit liegt und die Strafbarkeit somit am subjektiven Tatbestand scheitern würde.
Tatmehrheit, Spezialität & Co.: Konkurrenzverhältnisse im Louvre-Fall
Spannend wäre nun in einem letzten Schritt auch auf die einzelnen Konkurrenzverhältnisse einzugehen:
Ein Spezialitätsverhältnis liegt vor, wenn ein Tatbestand alle Merkmal eines anderen Tatbestands enthält sowie weitere. Dies ist allgemein im Verhältnis von Qualifikationen zu Grundtatbeständen der Fall sowie auch im Verhältnis von § 249 StGB zu § 242 StGB und § 249 StGB zu §§ 241, 240 StGB.
§ 123 StGB wiederum ist nicht bereits in §§ 242, 249 StGB enthalten, tritt aber als mitbestrafte Vortat möglicherweise zurück, da das Hauptgewicht der Tat auf dem Diebstahl, bzw. dem Raub liegt. Im Verhältnis zu der Einbruchsvariante des Diebstahls (§ 244 I Nr. 3 StGB) wiederum läge ein Spezialitätsverhältnis zugunsten des Diebstahls.
Man könnte annehmen, dass der § 303 I StGB eine mitbestrafte Nachtat des eigentlichen Diebstahls/Raubs darstellt. Dies erscheint zwar, was die Gewichtung der Tatbeiträge angeht naheliegend, allerdings erfolgte die Beschädigung der einzelnen Schmuckstücke “losgelöst” von der Tat: Es besteht hier kein zwingender Zusammenhang, wie es beim Einbruch der Fall war, der notwendig war, um die Schmuckstücke zu entwenden.
Beachte also, dass in den Konkurrenzverhältnissen eine ungeahnte Komplexität steckt, die du sowohl in der Klausur als auch der mündlichen Prüfungen beachten solltest - jedenfalls dann, wenn du (sehr) hohe Punktzahlen erreichen willst.