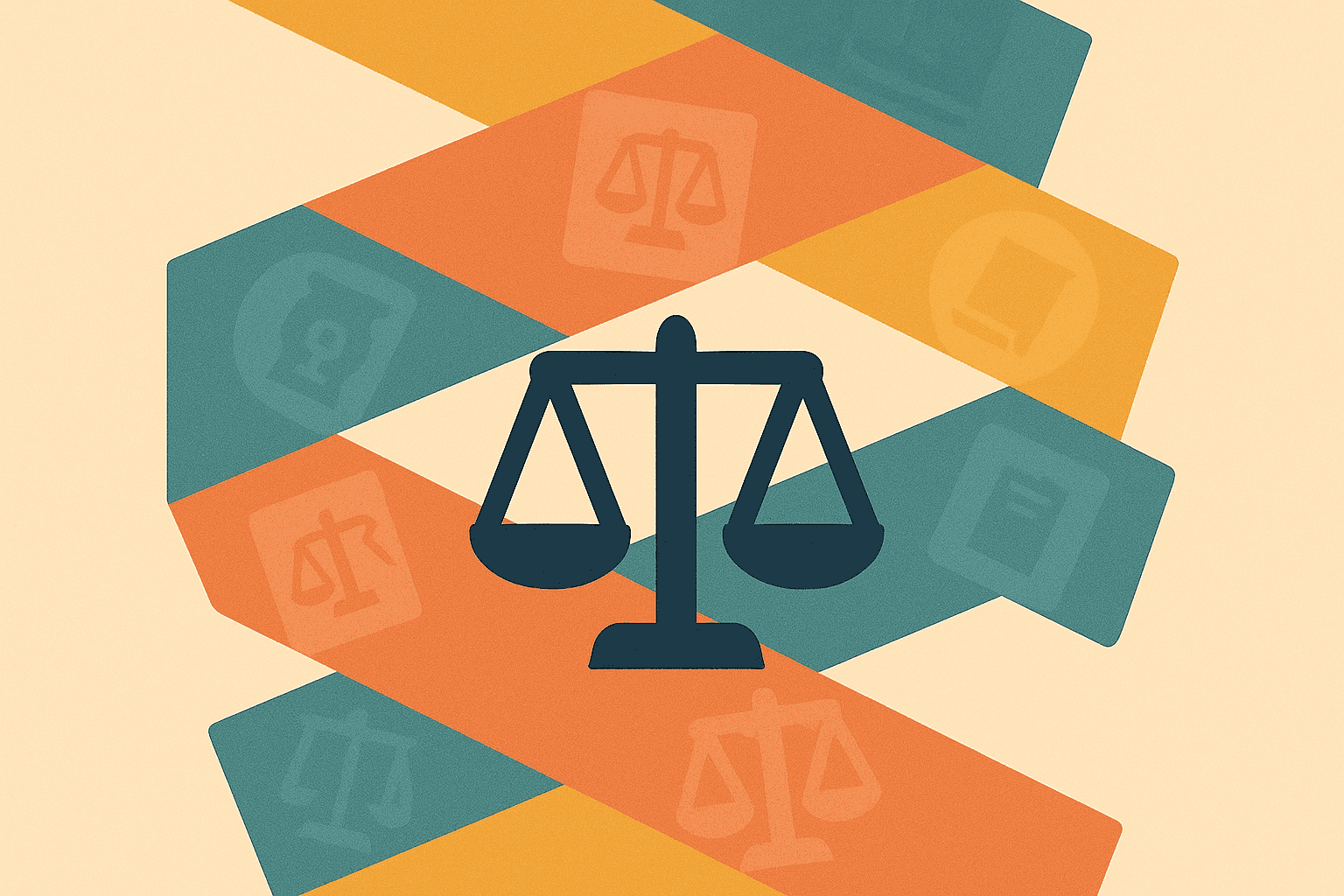Die Herausforderung im Jurastudium und das Prinzip Interleaving
In kaum einem anderen Studium ist die Stoffmenge so überwältigend, die Systematik so komplex und die Prüfungslast so gnadenlos wie bei Jura. Wer Jura studiert, kennt die ständige Spannung zwischen dem Wunsch nach Übersichtlichkeit und dem FOMO-Druck, jedes Detail zu beherrschen. Viele Studenten reagieren darauf mit linearem Lernen: Sie arbeiten ein Thema nach dem anderen ab, vertiefen es möglichst vollständig und wenden sich erst dann dem nächsten zu. Das mag intuitiv sinnvoll erscheinen, ist aber lernpsychologisch oft ineffizient. Denn ein Konzept, das in der Kognitionswissenschaft seit Jahren als besonders wirkungsvoll gilt, wird in der juristischen Ausbildung noch viel zu selten eingesetzt: Interleaving, auf Deutsch „vermischt lernen“. Interleaving bezeichnet eine Lernmethode, bei der verwandte, aber unterscheidbare Inhalte nicht isoliert, sondern im Wechsel miteinander bearbeitet werden. In der Praxis bedeutet das: Statt einen Monat lang nur Strafrecht zu lernen, beschäftigst du dich abwechselnd mit Strafrecht und Zivilrecht – und beschäftigst dich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden etwa beim Kausalitäts- oder Verschuldensbegriff. Anstatt ein Thema „abzuhaken“, bevor das nächste beginnt, lernst du sie gemeinsam, vernetzt und im Vergleich.
Warum vermischtes Lernen wirkt – und was die Forschung dazu sagt
Warum ist das sinnvoll? Die Antwort liegt in einem zentralen Ziel erfolgreichen Lernens: der Unterscheidung. Wer juristische Normen, Meinungsstreite oder Prüfungsschemata nur isoliert betrachtet, erkennt ihre Eigenheiten oft nur oberflächlich. Erst der direkte Vergleich offenbart die Nuancen – und zwingt dich, aktiv zu analysieren, zu entscheiden und anzuwenden. Genau hier setzt Interleaving an: Es schafft eine kognitive Umgebung, die dich immer wieder herausfordert, Begriffe voneinander abzugrenzen. Diese aktive Verarbeitung führt nachweislich zu einem tieferen Verständnis und langfristigerem Behalten. Dafür gibt es starke empirische Belege: Rohrer und Taylor (2007) zeigten, dass Schüler, die Mathematikaufgaben in zufälliger, vermischter Reihenfolge statt blockweise übten, später signifikant bessere Ergebnisse erzielten. Robert Bjork beschreibt Interleaving als „wünschenswerte Erschwernis“, die kurzfristig schwerer wirkt, aber langfristig am effektivsten ist. Auch Kornell und Bjork (2008) belegten, dass selbst komplexe konzeptuelle Inhalte – etwa im medizinischen Kontext – durch Interleaving besser verstanden und auf neue Situationen übertragen werden können.
Anwendung auf das Jurastudium und typische Missverständnisse
Jura ist kein Fach, das sich allein durch lineares Auswendiglernen bewältigen lässt. Es lebt von Abgrenzung, Systemverständnis und der Fähigkeit, bekannte Muster auf unbekannte Sachverhalte zu übertragen. Wer lernt, indem er Themen isoliert behandelt, erwirbt dieses Wissen zwar schneller, verliert aber System- und Transferverständnis. Viel effizienter ist es, diese Differenzierung von Anfang an zu trainieren – etwa durch den Vergleich von § 823 Abs. 1 BGB, § 826 BGB und § 831 BGB oder der Abgrenzung von § 227 BGB zu § 34 StGB und § 228 BGB zu § 35 StGB. Trotzdem begegnet Interleaving vielen Studierenden mit Skepsis. Oft herrscht das Missverständnis, man müsse ein Thema erst „beherrschen“, bevor man es mischt. Tatsächlich ist es gerade bei unsicherem Wissen besonders wirksam. Auch die Sorge, den Überblick zu verlieren, ist unbegründet – im Gegenteil: Die echte Struktur eines Rechtsgebiets zeigt sich erst im Kontrast zu anderen.
Fazit: Nachhaltiges Lernen durch gezielte Durchmischung
Wenn du dein Lernen effektiver gestalten willst, solltest du Interleaving als festen Bestandteil deiner Strategie etablieren. Wechsle regelmäßig zwischen verwandten Rechtsnormen, bearbeite gemischte Fälle und nutze problemorientierte statt thematisch sortierter Materialien. Scheue dich nicht vor der kognitiven Anstrengung – sie ist der Schlüssel zu nachhaltigem Lernerfolg. Was sich schwer anfühlt, wirkt. Nicht sofort, aber langfristig. Lernen bedeutet nicht nur, Wissen zu speichern, sondern es in Bewegung zu bringen, anzuwenden, zu unterscheiden und zu hinterfragen – genau das leistet Interleaving, besonders im Studium der Rechtswissenschaft.
Literatur
Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 185–205). Cambridge, MA: MIT Press.
bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/07/Bjork1994_MemoryAndMetamemory.pdf
Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the “enemy of induction”? Psychological Science, 19(6), 585–592.
doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02127.x
Richland, L. E., Kornell, N., & Kao, L. S. (2009). The pretesting effect: Do unsuccessful retrieval attempts enhance learning in the classroom? Journal of Experimental Psychology: Applied, 15(3), 210–219.
Rohrer, D., & Taylor, K. (2007). The shuffling of mathematics problems improves learning. Instructional Science, 35(6), 481–498.